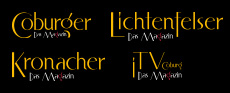Gesponserter Beitrag
Das Regionalwerk Obermain ist ein gemeinsames Kommunalunternehmen. Vorstand ist Markus Hausmann. Er entwickelt Projekte für erneuerbare Energien. Das kann die Sicherung von Flächen für Photovoltaik sein. Oder er sucht Standorte und Projektpartner für Windräder oder Nahwärmenetze. Das Regionalwerk ist der Knotenpunkt für erneuerbare Energien im Landkreis. Es vorsorgt zu einem zukünftigen Zeitpunkt Privatleute wie Unternehmen und Kommunen mit Energie. Und es produziert über eigene Projektgesellschaften diese Wärme und diesen Strom selbst. „Wir sind auch der Dienstleister, der all dies möglich macht und am Laufen hält“, erklärt Hausmann. Das kann die Wartung Nahwärmenetzes sein oder die Pflege der Grünflächen rund um die Photovoltaikanlagen. Hausmann wird als Vorstand des Regionalwerks für jedes Projekt eine Finanzierung sicherstellen. Dabei könnte das Regionalwerk je nach Projektgröße und -umfang einen Teil halten, der Rest wird über Kommunen, private Investitionen, Firmenbeteiligungen oder Banken beigesteuert.
Kleinere Photovoltaik-Anlagen werden die ersten sichtbaren Projekte des Regionalwerks Obermain sein. Sie sollen im ganzen Landkreis entstehen – und zwar sowohl auf Dächern als auch auf Freiflächen. Größere Anlagen werden mit einer eigenen Projekt-Gesellschaft entwickelt. An dieser können sich dann finanziell neben dem Regionalwerk auch die Kommunen, Firmen oder Privatleute beteiligen. Jede Kommune kann sich an diesen Anlagen beteiligen, muss es aber nicht. „Der jeweilige Stadt- oder Gemeinderat kann entscheiden, ob und in welcher Größenordnung er dabei sein möchte“, so Vorstand Markus Hausmann. Die Einnahmen fließen dann an die Anteilseigner zurück. „Privatleute wie auch Kommunen können sich so also auch ein Einkommen schaffen“, erklärt Hausmann.
Windräder können nur in sogenannten Wind-Vorrang-Gebieten gebaut werden. Sie haben eine längere Genehmigungszeit als Photovoltaik-Anlagen. Es wird also noch ein paar Jahre dauern, bis die ersten Windräder des Regionalwerks ihre Rotoren drehen. Die Finanzierung erfolgt analog über eine eigene Gesellschaft, an der sich Dritte beteiligen können.
Kommunen müssen künftig eine kommunale Wärmeplanung vorweisen. Darin müssen sie klarstellen, wie zum Beispiel ein Neubaugebiet mit Energie versorgt werden soll. Das kann dann bedeuten, dass ein Nahwärmenetz entsteht, an dem die Neubauten angeschlossen werden. „Je enger die Verbraucher nebeneinander stehen und je mehr Wärme sie verbrauchen, desto eher lohnt sich ein solches Netz“, so Vorstand Markus Hausmann. Momentan versorgt beispielsweise bereits ein Nahwärmenetz Landratsamt, Meranier-Gymnasium, Polizei, das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) und seit kurzem auch das Finanzamt. Auch in den einzelnen Kommunen können Nahwärmenetze entstehen. Es gibt dafür schon mehrere Projektideen und auch konkrete Objekte im Landkreis.
Der Landkreis und die elf Kommunen tragen das Regionalwerk Obermain. Die Rechtsform nennt sich gemeinsames Kommunalunternehmen (gKU). Dabei übernimmt der Landkreis ein Viertel der Kosten, die Kommunen teilen sich Dreiviertel. Die Anteile der Kommunen richten sich nach der Fläche und der Einwohnerzahl. Die Finanzierung von 300.000 Euro pro Jahr ist für die nächsten fünf Jahre gesichert. Kommunen und Kreis haben die Möglichkeit, selbst Strom und Wärme vom Regionalwerk zu beziehen, als auch sich an den Projektgesellschaften zu beteiligen. Die Kommunen und der Landkreis sind Träger des Regionalwerks und besprechen und genehmigen alle Projekte und den Handlungsrahmen über den Verwaltungsrat. Die Bürgermeister und der Landrat stellen per Satzung den Verwaltungsrat. Vorsitzender ist der Landrat, Christian Meißner. Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender ist der Hochstadter Bürgermeister Max Zeulner.
Privatleute und Unternehmen könnten, in einem zweiten Schritt, Energie künftig vom Regionalwerk Obermain beziehen. Damit unterstützen sie kurze Wege und die regionale Erzeugung von Energie. Außerdem können sie sich an der Energieerzeugung selbst beteiligen. Dies kann von Projekt zu Projekt anders sein. So könnte sich zum Beispiel Person A an einer Genossenschaft beteiligen, die bei allen Projekten des Regionalwerks Anteile finanziert. Person B ist Fan der Windkraft und beteiligt sich nur an den Windkraft-Projekten des Regionalwerks. Person C kauft für ihre Enkel Anteile an der Photovoltaik- Anlage neben dem Dorf. Oder sie beteiligen sich in der Größenordnung, in der ihr Unternehmen Energie verbraucht. „Das Entscheidende ist, dass alle, die sich beteiligen, davon auch wieder profitieren. Die Erträge werden an sie ausgeschüttet“, so Vorstand Markus Hausmann.